
Foto: Bjarne Meisel
Bianca Nawrath, wie blickst du in dein feministisches Spiegelbild?
Im letzten Jahr habe ich das Buch Wenn ich dir jetzt recht gebe, liegen wir beide falsch von Bianca Nawrath gelesen und geliebt. Umso mehr habe ich mich über die Möglichkeit gefreut, ein Interview mit der Schauspielerin und Autorin zu führen, das ich definitiv in der Kategorie "Luxusproblem" verorten würde. Denn mir sind so viele Fragen an die 28-Jährige in den Kopf geschossen, dass ich mich ehrlicherweise ziemlich bremsen musste, ihr nicht gleich einen ganzen Fragenkatalog zukommen zu lassen. Und so darf ich endlich mal wieder ein Interview mit einer sehr beeindruckenden und inspirierenden Frau vorstellen, die nicht nur sehr sehr ehrlich ist, sondern sich darüber hinaus nicht scheut, den sprichwörtlichen Finger in die Wunde zu legen. Denn Bianca spricht offen über Feminismus, Sexismus in der Film- und Unterhaltungsbranche, Migration und die Frage, ob sie selbst manchmal auch in die Genderklischee-Falle tappt. Darüber hinaus ist sie seit heute (15. April) in der 4. Staffel von WaPo Duisburg zu sehen? Klingt gut? Ist es auch!
In diesem Sinne habe ich folgende Empfehlung für euch: Erst das Interview mit Bianca lesen und dann die neuen Folgen der ARD-Reihe im TV (jeden Dienstag, 18.50 Uhr im Ersten) oder in der ARD-Mediathek gucken.
*** Dieser Artikel enthält Affiliate-Links ***
Liebe Bianca, welche Rolle spielt Selbstironie in deinem Leben?
Bianca Nawrath: Ich bin in unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedlich selbstironisch. Beruflich fällt es mir am leichtesten. Ich hätte wohl längst aufgehört, Romane zu schreiben, würde ich jede Kritik persönlich nehmen. Wenn ich Figuren entwickle, reite ich sie gerne in die Scheiße und schaue dann dabei zu, wie sie sich selbst da raus arbeiten. Dabei entpuppen sich oft die Figuren als die besten Überlebenskünstler*innen, die gut über sich selbst lachen können. Insofern kann ich auch aus meinen Geschichten und von meinen Protagonist*innen lernen, denn privat wäre ich oft gerne selbstironischer.
Aktuell bist du in der 4. Staffel von WaPo Duisburg als Klara Proske zu sehen. Nimm uns bitte einmal mit und beschreib uns deine Rolle.
Klara ist die Tochter des Polizeipräsidenten, war ein Überflieger in der Polizeischule und ist auf bestem Wege, Erfolg bei der Kripo zu machen. Doch ihr Chef, der Kriminalhauptkommissar Carsten Heinrich (Stefko Hanushevsky), macht es ihr nicht leicht. Umso mehr fühlt sie sich in ihrem Wunsch bestärkt, als Hospitantin bei der Wasserschutzpolizei einzusteigen. Klara hat Bock auf Action, nicht auf Schreibtischarbeit. Gleichzeitig will sie sich von ihrem Vater frei machen. Sie ist direkt, witzig, smart – nur manchmal vielleicht etwas zu übereilig. Ich habe Klara echt ins Herz geschlossen.
Viele Schauspieler*innen sagen, sie können eine Rolle nur dann spielen, wenn sie sich selbst in ihr erkennen. Wie stehst du zu diesem Glaubenssatz?
Es gibt keinen Menschen auf der Welt, mit dem man nichts gemeinsam hat. Selbst als ich eine Killerin in dem Krimi Miss Merkel gespielt habe, habe ich Parallelen zu mir entdecken können. Im Leben wie in meinem Job liebe ich es, nach diesen Gemeinsamkeiten zu suchen. Es wäre wohl verblendet zu behaupten, man würde nicht in jede Rolle etwas von sich reinstecken. Ich glaube nicht, dass sich das verhindern lässt. Und irgendwie gibt mir das auch ein Gefühl von Sicherheit, wenn ich meiner Rolle ähnlich bin, denn dann habe ich eher das Gefühl, ihrer Perspektive gerecht zu werden. Gleichzeitig reizen mich auch Rollen, die lauter sind als ich im echten Leben bin. Am Set bezahlt rumschreien und Chaos stiften – ist doch klasse! Solche Rollen befriedigen meine Spielwut und machen Laune.
Wie viel Bianca steckt also in Klara?
Unter anderem hat es mich gereizt, Klara zu spielen, weil sie mir im Buch noch nicht eindeutig gezeichnet schien. Umso mehr Spielraum blieb für mich. Wir haben eine Woche lang als Main Cast miteinander geprobt, sind die Texte durchgegangen und dabei konnte ich herausfinden, wie ich die Rolle anlegen will. Klara wurde von ihren Eltern adoptiert. Das ist zwar eine Erfahrung, die ich nicht teile, aber als Tochter von polnischen Migrant*innen kann ich zumindest nachvollziehen, wie es ist, seinen Eltern gegenüber einen besonderen Dank zu empfinden. Weil sie viele Hürden auf sich genommen haben, damit ich es mal besser habe. Daraus resultieren Gefühle von Liebe und Sicherheit, aber auch ein enormer Druck. Klara empfindet ihrem Vater gegenüber eine große Verpflichtung, gleichzeitig hat sie eigene Träume, die sich von seinen unterscheiden. Diese Zerrissenheit in Klara abzubilden, der Kampf einer jungen Frau, die nach einem Weg sucht, die Erwartungen anderer zu erfüllen, ohne ihre eigenen Wünsche dabei zu verraten – das hat mir Spaß gemacht.
"Ich erwische mich oft dabei, Angst davor zu haben, anstrengend zu sein. Auch jetzt, in diesem Moment, in dem ich das schreibe. Es ist fast immer leichter, nicht zu widersprechen und mitzumachen."
Seit rund einem halben Jahr schreibst du für das SZ Magazin die Set-Kolumne Die will doch nur spielen. In der Kolumne widmest du dich u. a. der Frage, was es über dich aussagt, berühmt sein zu wollen. Ohne den Inhalt deines Textes vorwegnehmen zu wollen, aber ist es womöglich ein Problem unserer Sozialisierung, dass vor allem Frauen möglicherweise unsympathischer wahrgenommen werden, wenn sie konkrete Karriereziele verfolgen?
Von klein auf werden Mädchen oft stärker auf Harmonie, Anpassung und soziale Kompetenzen konditioniert, während Jungen eher zu Wettbewerb und Durchsetzungsfähigkeit ermutigt werden. Wenn Frauen dann selbstbewusst auftreten oder ambitionierte Ziele verfolgen, widerspricht das unbewusst dem ausgedachten Idealbild der netten, bescheidenen Frau. Einige finden uns dann unsympathisch, arrogant oder verbissen. Männer, die dasselbe tun, gelten hingegen als zielstrebig oder führungsstark. Ich erwische mich oft dabei, Angst davor zu haben, anstrengend zu sein. Auch jetzt, in diesem Moment, in dem ich das schreibe. Es ist fast immer leichter, nicht zu widersprechen und mitzumachen. Aber das ist eine Rechnung auf Zeit: Die Macht, die mir als junge Frau hier und da überlassen wird, vergeht mit dem Alter. Studien zeigen: Männer über 50 bekommen noch zentrale Rollen, Frauen kommen dann hingegen kaum noch vor oder nur in Nebenrollen. Ist doch Scheiße. Ich will es aushalten lernen, als anstrengend wahrgenommen zu werden, denn manchmal ist es nötig, dass wir anstrengend sind. Da muss das Harmoniebedürfnis kurz mal hintenanstehen. Allein schon aus Respekt vor den Generationen von Frauen vor uns, die mit wesentlich weniger Möglichkeiten für unsere Rechte gekämpft haben. Wir sind heute an einem stabilen Punkt angekommen, auf den gilt es aufzubauen.
Ich würde gerne mit dir über Sexismus in der Film- und Unterhaltungsindustrie sprechen. Ein Wandel findet statt, keine Frage – wie nimmst du das Bewusstsein für übergriffiges Verhalten und Äußerungen in der Branche wahr?
MeToo hat echt was verändert. Manchmal fragt man sich ja, ob demonstrieren zu gehen, ob Stimme zu zeigen, ob der ganze Bummens wirklich was bringt und ich kann versichern – ja, das tut es! Ich kenne Frauen, die ganz direkt aussprechen, wie wichtig MeToo für sie war, um ihre Scham aufzuarbeiten, ihre Vergangenheit besser einordnen zu können, sich weniger allein zu fühlen.
Am Set gibt es nun das Berufsbild der Intimacy-Koordinatorin, die intime Szenen wie einen Stunt mit uns einübt. Das ist schon mal viel wert, aber ich denke, dass sich die Dinge noch viel grundsätzlicher ändern müssen, denn Übergriffe passieren hinter der Kamera wahrscheinlicher als vor der Kamera. Machtmissbrauch hat viele Facetten und begrenzt sich nicht auf Körperlichkeiten. Selbst wenn wir nicht selbst in den Machtpositionen sitzen, um systematisch etwas zu verändern, kennen wir vielleicht Führungskräfte und können ihnen gegenüber Forderungen aussprechen. Machtmissbrauch wird nicht nur durch Aufklärung vorgebeugt, sondern vor allem, indem wir gleichberechtigt bezahlen und engagieren. Das ist aus meiner Sicht die wichtigste Forderung. Manche Leute haben Angst, dass der Kampf um Gleichberechtigung dazu führt, dass man jetzt gar nichts mehr sagen darf – aber im Gegenteil geht es ja darum, dass man alles sagen kann, ohne sich schämen zu müssen oder um die eigene Existenz zu bangen.

Credit: Lena Faye
Wie blickst du in dein feministisches Spiegelbild? Ertappst du dich manchmal dabei, hier und da doch auch mal in eine Genderklischee-Falle zu tappen? Immerhin steckt in uns allen jede Menge Sozialisation, die uns geprägt hat …
Ständig. Ich finde kleine Jungs, die eine sanfte Seite zeigen, extrem niedlich, bei Mädchen nehme ich es schneller für selbstverständlich. Ich rasiere mich, gehe Joggen, auch wenn ich keine Lust habe, ich habe Angst, anstrengend zu sein, ich gefalle mir als einzige Frau in Männerrunden, spiele das lachende Publikum, auch bei halbstarken Witzen. Sophia Fritz beschreibt in ihrem Buch Toxische Weiblichkeit verschiedene „Kategorien“ von Frauen. Auch wenn ich mich in vielen wiedererkenne, habe ich mich am meisten beim „guten Mädchen“ ertappt gefühlt. Manchmal neige ich zur Überanpassung, will kümmernd und liebevoll auftreten. Im nächsten Moment will ich die resolute, taffe Frau sein. Im übernächsten die lockere, witzige Kumpelin – je nachdem, was ich erwarte, dass mein Gegenüber mögen könnte. Dass ich das so offen zugebe und ein Bewusstsein dafür entwickelt habe, ist bereits ein Symptom der Arbeit an einem ehrlichen Selbstbewusstsein.
"Meine Eltern haben mir dort ein tolles Zuhause geschaffen. Ich will, dass ihre Leistung und die vieler anderer Familien in sogenannten Betonwüsten gesehen wird."
Du nutzt deine Stimme und sprichst öffentlich über gesellschaftsrelevante Themen und scheust dich nicht, hier und da auch mal den sprichwörtlichen Finger in die Wunde zu legen. Findest du, dass jeder Mensch mit einer gewissen Reichweite diese auch nutzen sollte, um auf bestimmte Themen hinzuweisen?
Niemand muss irgendwas, aber ich finde es auf jeden Fall cool, wenn Leuten nicht alles egal ist, wenn sie zu ihren Herzensthemen stehen und sich stark machen. Doch Engagement zeigt sich nicht nur in der Öffentlichkeit. Im Gegenteil: Am allerwichtigsten ist sie im direkten Umfeld, der Nachbarschaft, im Freundeskreis, in der Familie. Ich wünsche mir, dass wir wieder mehr Gesellschaft leben.
Schwingt dennoch auch bei dir die Sorge mit, im Zuge von gesellschaftskritischen Äußerungen gecancelt zu werden?
Canceln ist ein spannender Begriff. Ob die Debatte sich aufgeheizt hat? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das Netz und die Nachrichtenflut sorgen vielleicht dafür, dass es uns so vorkommt. Aber Canceln, das ist auch ein Kampfbegriff der AfD. Die wollen, dass wir über jungen Linke denken, dass die die ganze Zeit am canceln sind. Am ehesten canceln sich Linke doch gegenseitig. Teils anstrengend besserwisserisch, teils mit demokratischem Anspruch, immer zu Gunsten der erstarkenden Rechten. Ich habe das Gefühl, es trifft oft die Falschen, wenn in Anführungsstrichen gecancelt wird. Rammstein verdient weiter fleißig mit Konzerttickets. Die AfD wird in Talkshows eingeladen. Trump wurde wiedergewählt. Die wirklichen Arschlöcher haben gute Anwälte, Berater*innen, bleiben verschont. Ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft eine neue Streitkultur entwickeln, speziell in Hinblick auf die Entwicklungen im Netz. Und sollte ich doch mal gecancelt werden, mache ich es Höcke und Co. nach. Ich begebe mich in eine Opferrolle. Dann gewinne ich sogar noch an Beliebtheit als vermeintlicher Underdog.
Lass uns über deine Arbeit als Autorin sprechen: Dein Roman Iss das jetzt, wenn du mich liebst etwa wurde mit den Worten „Ein Roman wie polnische Kluski: Reichhaltig, rund, von innen heraus wärmend“ beschrieben. Wieviel deines Lebens als Tochter polnischer Eltern steckt in deinen Geschichten?
Am liebsten würde ich jetzt erst mal über Essen reden. Essen ist eines meiner Lieblingsthemen. Aber vielleicht lässt es sich verbinden: In Polen gibt es das Sprichwort Masło maślane (gebutterte Butter). Es beschreibt Dinge, die doppelt gemoppelt sind. Migration bedeutet immer, dass Geschichten verloren gehen können, deshalb erzähle ich sie gerne wieder und wieder und wieder. Fett ist Geschmacksträger, Geschichten sind Beziehungskleber. Sie halten mich mit meiner Familie, meinen Gefühlen, meinem Leben zusammen. Ich bin mit zwei Kulturtorten gesegnet, von denen ich mich nach Belieben bedienen kann und will deshalb auch von beiden Kulturen erzählen.
Du bist im Märkischen Viertel in Berlin aufgewachsen. In einem Interview hast du einmal gesagt, die Klischees rund um diesen Bezirk nerven dich. Was genau nervt dich?
Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die keine Berührungspunkte mit Plattenbausiedlungen haben, merke ich meistens, dass sie sich das ziemlich assi vorstellen. Sie denken an 4Blocks, Drogendealer und Co. In der TAZ habe ich darüber geschrieben, dass ich erst anfing, gern zu erzählen, wo ich aufgewachsen war, als wir aus dem Märkischen Viertel rausgezogen waren. Plötzlich war ich stolz auf etwas, für das ich mich früher geschämt hatte. Ich integrierte meine Vergangenheit in eine Selbsterzählung irgendwo zwischen Aufsteigergeschichte und Lederjackenimage. Etwas, das mir früher mitleidsvolle Blicke beschert hatte, verschaffte mir plötzlich Anerkennung. Ich habe mich für den Artikel mit verschiedenen Menschen im MV getroffen und sie porträtiert. Begleitet von Bjarne Meisel, der fantastisch feinfühlig Fotos gemacht hat: Leben im Märkischen Viertel: Stolz und Vorurteil.
Inwiefern hat dich die Tatsache, in diesem Teil Berlins ausgewachsen zu sein, geprägt und in deinem Sein beeinflusst?
Ich habe verstanden, dass sich die Geschichte um einen Ort und seine Menschen manchmal leichter verkaufen lässt, als die Wahrheit(en). Und ich wohne bis heute gerne weit oben, vermisse Müllschlucker, hab keine Angst vor Fahrstühlen und ein warmes Gefühl im Bauch, wenn ich an Plattenbauten vorbeifahre. Meine Eltern haben mir dort ein tolles Zuhause geschaffen. Ich will, dass ihre Leistung und die vieler anderer Familien in sogenannten Betonwüsten gesehen wird.
Angenommen, du dürftest dir eine Filmrolle auf den Leib schneidern – wie sähe diese Figur aus?
Ich will eine Piratin spielen!
Du hast ein neues Podcast-Projekt ins Leben gerufen. Worum geht’s?
Migration ist das bestimmende Thema der letzten Monate, aber kaum jemand redet mit Migrant*innen über ihre Themen. In meinem eigenproduzierten Podcast Kartoffelparty treffe ich Menschen mit Migrationserfahrung. Das ist fast jeder Dritte in Deutschland, bei den unter 5-Jährigen sind es 42 Prozent. Wir sind mehr als wir denken und stark, wenn wir zusammenhalten. In dem Podcast reden wir über Musik, Film, Sprache, Bildung, Medizin, Politik, Humor, Essen – alles, was uns bewegt. Ein Treiber für den Podcast ist meine Wut über den Rechtsruck in unserem Land. Als weiße, christliche, polnische Frau gehöre ich zu den Lieblingsausländern der Deutschen. In letzter Zeit höre ich häufiger den Satz: „Wenn sie sich nur so integrieren wie ihr, dann ist ja gut“. Aber ich will nicht als Ausrede für Rassismus herhalten. Zum einen bekommen nicht alle Ausländer die gleichen Möglichkeiten, sich anzupassen und zum anderen, empfinde ich den Weg der Überanpassung, den meine Familie gewählt hat, rückblickend als schade. Er war mit enorm viel Scham verbunden und hat uns müde gemacht.
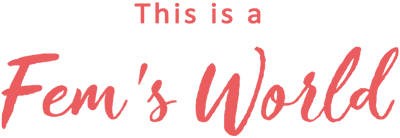




Hinterlasse einen Kommentar