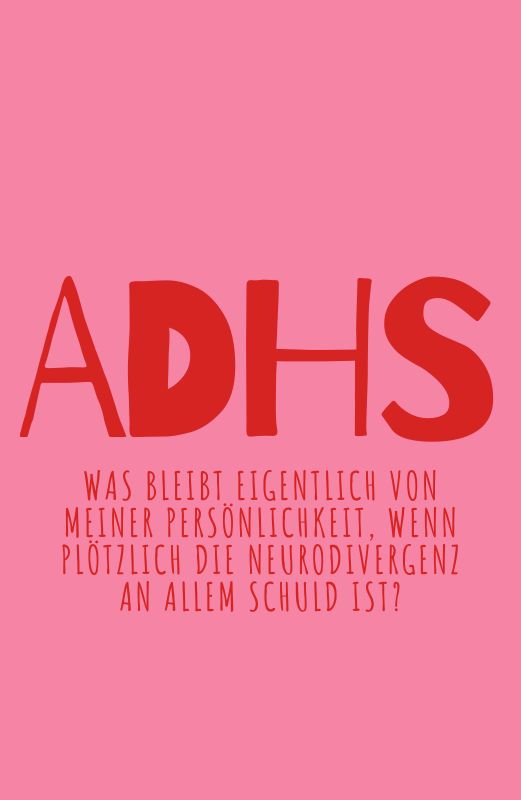Foto: UnsplashHoach Le Dinh
Wieso schämen wir uns eigentlich, „Ich schaff das nicht“ zu sagen?
An manchen Tagen schaffe ich es nicht einmal, die Waschmaschine anzustellen. Diese Tage, an denen die Deadlines nur so vorbeirauschen und selbst das Beantworten von WhatsApp-Nachrichten zu viel Energie in Anspruch nimmt, weil es mir schon alles abverlangt, mich in Jogginghose und Kuschelsocken mit dem Laptop auf dem Sofa einzurollen, ein paar Emails zu schreiben und Studiarbeiten zu korrigieren, sind nicht etwa Überbleibsel einer Pandemie, sondern – darf ich vorstellen? – meine chronische Erschöpfung.
"Selbst als ich knietief in meiner ersten richtigen Erschöpfungsphase steckte, dachte ich noch, der Schlüssel, um da rauszukommen, sei ein kurzer Urlaub, um dann – na, wer ahnt es? – einfach weiterzumachen."
Klar, solche Tage kennen wir alle und im ersten Moment fällt es leicht, mit Gelassenheit zu reagieren: Ist okay, lass dir Zeit, Gesundheit geht vor. Trotzdem, selbst nach vier Jahren, in denen es an Arztbesuchen, (Verdachts-)Diagnosen und zig verschiedenen Behandlungstherapien nicht gemangelt hat, hat sich eine Sache so fest eingeprägt wie ein Fußabdruck in frischem Beton: Mir fällt es schwer, „Ich schaffe das nicht“ zu sagen. Wenn in solchen Phasen selbst die essentiellsten Alltagsaufgaben nicht zu bewältigen sind, weit mehr als nur das Geschirr liegen bleibt und die To-Dos sich häufen, fühlt sich das nämlich alles andere als „okay“ an. Weil ich, von außen betrachtet, keinen sichtbaren Grund habe, „nicht mehr“ zu können. Ich fühle mich, als würde ich versagen, im Alltag, im Job, im Leben – kurz, als Erwachsene.
Die Rolle von Social Media
Dabei hat die Entwicklung auf sämtlichen Social-Media-Plattformen in den letzten Jahren doch erst zu einem positiveren und offenen Umgang mit dem Thema #mentalhealth geführt. Und das ist eine tolle Entwicklung, immerhin erleiden laut der DGPPN (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V.) 27,8% der Erwachsenen in Deutschland jedes Jahr eine psychische Erkrankung. Das Thema sollte also weiterhin dringend Beachtung bekommen. Wieso fällt es mir – und vielen anderen Menschen – also so schwer, die eigene Gesundheit auch vor anderen zu priorisieren und das zu kommunizieren?
In der einen Insta-Story werden wir dazu aufgefordert, mehr Pausen zu machen, bevor es zu spät ist – ehe uns im nächsten Slide medial bekannte Gesichter mit eindringlicher Miene erzählen, seit drei Jahren keinen einzigen Tag Urlaub mehr gemacht zu haben. Die Prahlerei vom pausenlosen Arbeiten bringt uns aber nicht dazu, jetzt alles stehen und liegen zu lassen, im Gegenteil: Sie hilft, uns umso mehr über die Arbeit zu definieren. Sie drückt der so wichtigen Erholung den Stempel der Faulheit auf.
Die 80-Stunden-Woche als Statussymbol
Eine meiner engsten Freundinnen beschrieb letztens einen Mitstreiter in einem Seminar mit den Worten „Der hat die Arbeit auch nicht erfunden.“ Bis vor einigen Jahren wäre diese Aussage mir wahrscheinlich selbst noch über die Lippen gekommen. Heute frage ich mich, wann Vielarbeit zu einem Statussymbol geworden ist. Die Selbstdefinition über Leistung hat sich jahrelang auch bei mir gehalten: 80-Stunden-Wochen in der Werbeagentur waren keine Seltenheit, eine Grippe kein Grund, nicht zu arbeiten (vor der Pandemie) und im darauffolgenden Job war jedes Wochenende, das ich nicht für meine Doktorarbeit nutzte, ein verlorenes Wochenende.
Selbst als ich knietief in meiner ersten richtigen Erschöpfungsphase steckte, dachte ich noch, der Schlüssel, um da rauszukommen, sei ein kurzer Urlaub, um dann – na, wer ahnt es? – einfach weiterzumachen. Was wirklich hilft, sind vor allem Veränderungen im Lebensstil und die Bereitschaft, (professionelle) Hilfe anzunehmen. Obwohl ich es heute besser weiß als damals, versuche ich noch, die richtige Balance zu finden. Denn dieser stressfreie Lebensstil kollidiert ein wenig mit meinen persönlichen Vorstellungen von einem erfüllten Leben – ein Leben, in dem Arbeit trotz allem einen großen Platz hat. Arbeit, die ich gern mache. Und für die mir manchmal die Kraft fehlt.
"Doch so lang der Weg aus der Erschöpfung auch noch sein mag, ich lerne immer besser, mir selbst gegenüber Mitgefühl und Verständnis zu üben. Meine Ziele lasse ich mir nämlich von keiner Erschöpfung durchkreuzen; egal, wie viele Deadlines ich noch verschieben muss."
Mit Mitgefühl und Verständnis zum Ziel
Vielleicht liegt darin ein weiterer Grund, wieso es mir so schwer fällt, Deadlines zu verschieben und Aufträge abzusagen. Ich glaube, ich will an vielen Stellen noch nicht wahrhaben, dass ich nicht immer so kann, wie ich gern möchte. Doch so lang der Weg aus der Erschöpfung auch noch sein mag, ich lerne immer besser, mir selbst gegenüber Mitgefühl und Verständnis zu üben. Meine Ziele lasse ich mir nämlich von keiner Erschöpfung durchkreuzen; egal, wie viele Deadlines ich noch verschieben muss.
Denn was wirklich zählt, sind keine Zeitpläne. Es ist die Tatsache, dass ich endlich angefangen habe, folgende magische Worte auszusprechen: „Sorry, ich kann das gerade nicht, wir müssen verschieben.“ Die Antwort darauf waren Mitgefühl und Verständnis statt Verurteilung. Manchmal sind es doch wir selbst, die am schärfsten mit uns ins Gericht gehen.