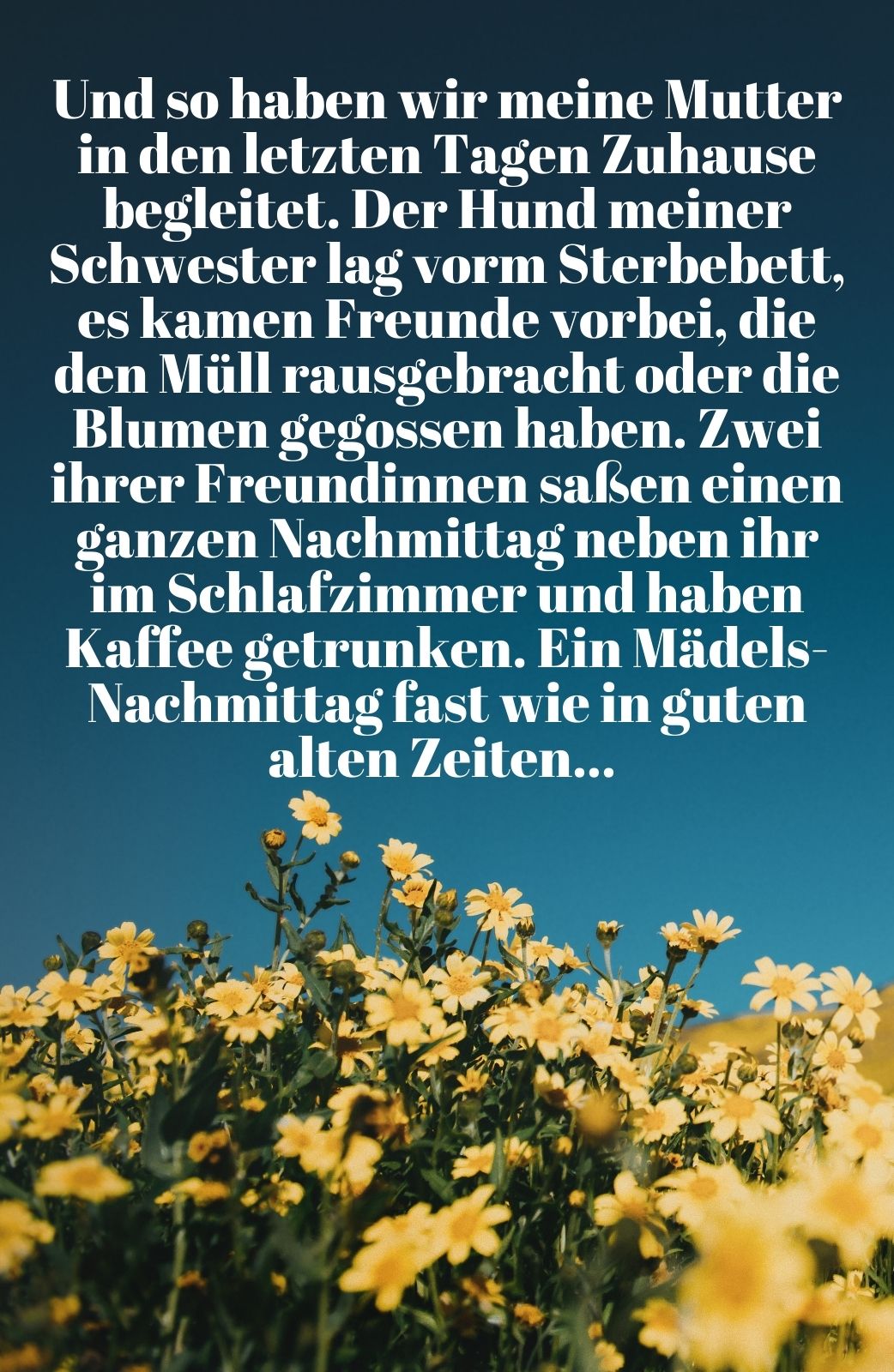
Nicht jedem Ende wohnt ein Zauber inne – aber manchmal doch noch eine Pointe. Ein Mutmacher für die letzten Stunden im Leben
Heute möchte ich ein liebevolles Plädoyer dafür aussprechen, das Thema Sterben wieder selbstverständlicher und mutiger in die Mitte unseres Lebens zu rücken.
Meine Mutter ist mit 59 Jahren an Darmkrebs gestorben und wir haben in den vergangenen drei Jahren auch meinen Großvater und meine Schwiegermutter gehen lassen müssen. Alle Drei sind durch eine schwere Krankheit, aber mit unserer Begleitung oder irgendwie mitten im Familientrubel gestorben. Das ist keine Selbstverständlichkeit und grundsätzlich ein großes Geschenk. Aber natürlich eins, das ziemlich scheiße verpackt und schwer zu behalten ist. Eins von diesen Geschenken, die wir alle gerne umgetauscht hätten, die sich aber leider nicht umtauschen lassen.
"Die letzten Tage meiner Mutter waren die schwersten Tage meines Lebens, aber gleichzeitig auch die schönsten. Wir haben als Familie miteinander geweint, wir waren zusammen kraftlos und wir haben sehr große Portionen Spaghetti Bolognese gekocht. Meine kleine Tochter hat am Sterbebett ihrer Oma Haferflocken gegessen und Kinderlieder gesungen"
Unter Corona war die Sterbebegleitung innerhalb der Familie oft nicht möglich und der Tod kam viel plötzlicher. Aber auch ohne Corona gibt es vermutlich mehr Menschen, die nicht liebevoll loslassen dürfen oder die keine Zeit bekommen, in einem liebevollen Umfeld zu sterben. Aber wie das so ist, hier in meiner Kolumne, kann ich nur meine Geschichte erzählen. Was mich bewegt diesen Text zu schreiben, ist der Mut, der mir damals gemacht wurde, meine Mutter mit Selbstverständlichkeit und Liebe durch ihren Sterbeprozess zu begleiten. Und das würde ich unglaublich gerne weitergeben.
Meine Tochter war gerade zwei Jahre alt, als mich ein Anruf erreichte, den ich zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht erwartet hatte. Wir Schwestern sind dann über Nacht aus Neuseeland, Hamburg und Zürich nach Hause geeilt, mitten aus unserem Alltag gerissen, mit unseren Familien, mit all den Sorgen und Fragen, was uns jetzt erwartet. Und wir hatten Glück! Wir alleine hätten vermutlich nicht den Mut aufgebracht, uns dem Sterbeprozess unserer Mama so unmittelbar zu stellen, wie wir es dann getan haben. Im Umfeld meiner Mutter waren glücklicherweise ein paar Menschen, die bereits einen sterbenden Menschen begleitet hatten. Und die haben uns Mut gemacht! Mut, dass diese Erfahrung uns keineswegs traumatisiert, sondern auch einen Zauber, eine Ruhe und einen Humor birgen kann, den wir uns vorher nicht zugetraut und auch so gar nicht erwartet hätten. Also haben wir uns reingeworfen, mit Kind und Kegel. Die letzten Tage meiner Mutter waren die schwersten Tage meines Lebens, aber gleichzeitig auch die schönsten. Wir haben als Familie miteinander geweint, wir waren zusammen kraftlos und wir haben sehr große Portionen Spaghetti Bolognese gekocht. Meine kleine Tochter hat am Sterbebett ihrer Oma Haferflocken gegessen und Kinderlieder gesungen.
Wir hatten aber nicht nur gute Freunde, sondern auch die wundervolle Hilfe des Palliativdienstes. Menschen, die wissen, wie Sterben geht. Hebammen fürs Loslassen. Wir haben in Deutschland ein so wunderbares und hilfreiches Netz an Palliativdiensten, die Menschen Zuhause oder im Hospiz begleiten. Sie helfen übrigens dem, der gerade geht, aber auch dem, der bleibt. Sie haben uns all die Fragen beantwortet, die wir uns nie zuvor gestellt hatten. Wie viel Wasser trinkt ein Mensch während er stirbt? Darf meine Mutter auch einen Schluck Rotwein haben? Wie klingt der letzte Atemzug? Und was machen wir dann …?
Eigentlich ging es am Ende ein bisschen zu wie in einem Taubenschlag – und das war genau richtig für meine Mutter!
Und so haben wir meine Mutter in den letzten Tagen Zuhause begleitet. Der Hund meiner Schwester lag vorm Sterbebett, es kamen Freunde vorbei, die den Müll rausgebracht haben oder die Blumen gegossen. Zwei ihrer Freundinnen saßen einen ganzen Nachmittag neben ihr im Schlafzimmer und haben Kaffee getrunken. Ein Mädels-Nachmittag fast wie in guten alten Zeiten … Eigentlich ging es am Ende ein bisschen zu wie in einem Taubenschlag – und das war genau richtig für meine Mutter! Sie hatte vier Kinder groß gezogen und durfte in dem Trubel sterben, den sie kannte und liebte. Meine Großmutter wiederum hat ihren Mann in den letzten Tagen viel im Arm halten dürfen und die beiden haben bewusst und in aller Ruhe Abschied genommen. Von sich als Paar und von der Welt, die sie seit über sechs Jahrzehnten gemeinsam kannten. Und meine Schwiegermutter? Die hat grundsätzlich ungern übers Sterben gesprochen und wir brauchten viel Bauchgefühl, um sie auf diesem Weg zu begleiten. Aber mit dem gleichen Dickkopf, mit dem sie durchs Leben gegangen war, hat sie es auch zügig und unkompliziert losgelassen. Nach diesen drei Todesfällen denke ich: Wenn wir die Zeit dafür bekommen, dann sterben wir vermutlich genauso wie wir auch gelebt haben … dann gehört das Sterben einfach ganz normal mit dazu, ein bisschen als Fortsetzung unseres Alltags mit allen Facetten, die uns ausmachen.
Meine Mama lag noch in ihrem Bett, eine Kerze brannte und wir haben das Fenster ein Stück gekippt, damit die Seele weichen kann, wie man so schön sagt. Es roch nach Lavendel und auch irgendwie nach Tod. Meine kleine Tochter schlief in ihrem Reisebett und meine Schwestern waren in ihren Wohnungen oder im Hotel, um mal kurz durchzuschnaufen. Die Männer vom Bestattungsinstitut traten ganz ruhig durch die Tür. Ob man die Treppe zum Dachboden noch ausbauen müsse, um mit dem Sarg um die Ecke zu kommen? Zu kompliziert. Dann halt einfach in einem Leichensack und forsch runter in den Leichenwagen. Ich sah den Bestatter noch am Sterbebett bekreuzigen und dann schlossen sie die Tür zum Wohnzimmer. Ich saß auf dem Sofa meiner Mutter und es war unglaublich still. Die Nachmittagssonne schien durchs Fenster und ich fragte mich, ob ich das Bett gleich neu beziehen sollte, wenn sie gegangen war. Ganz schön gruselig, so ein Raum, in dem jemand gestorben ist – als sie noch geatmet hat, war er voller Selbstverständlichkeit und Liebe. Das ist also Sterben, dachte ich. Das ist ja total ohne Pointe! Und dann sah ich durchs Milchglas, wie sie meine Mutter hochkant aus der Tür trugen. Gut, dachte ich. Immerhin verlässt sie aufrecht das Haus – und damit auch mit einer verdienten Pointe.



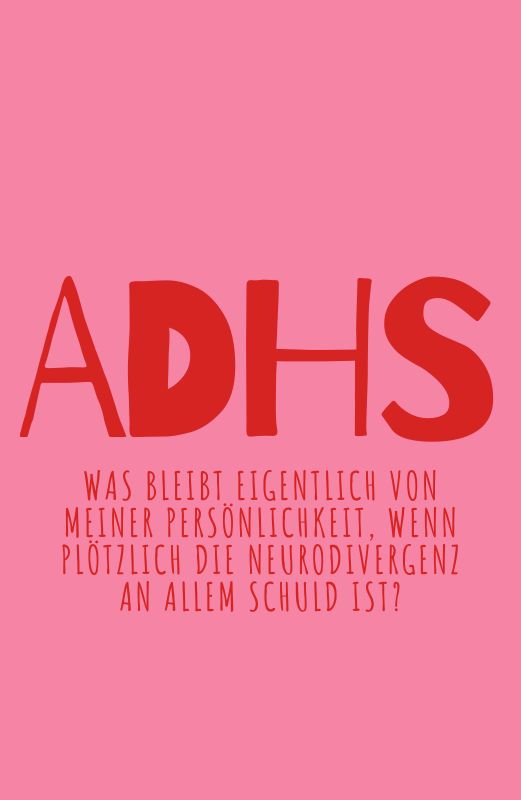

Hinterlasse einen Kommentar